Das ist eine gute Nachricht für die Berufsbildung. Fast 45 000 junge Menschen haben an einer umfassenden nationalen Umfrage teilgenommen, die Ende 2024 vom Kompetenzzentrum Arbeit und psychische Gesundheit WorkMed in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und dem Meinungsforschungsinstitut ValueQuest durchgeführt wurde. Ihre Botschaft ist klar: Der überwiegenden Mehrheit der Lernenden geht es gut. Über 80% geben an, sich im Alltag ihrer Lehre «eher gut» oder «sehr gut» zu fühlen.
Diese jungen Menschen geben sich nicht damit zufrieden, «durchzuhalten». Sie berichten, dass sie motiviert und stolz auf ihren Beruf sind sowie in ihrem beruflichen Umfeld wertgeschätzt werden. Das Arbeitsklima beschreiben sie als wohlwollend, respektvoll und fördernd. Viele erwähnen ein Vertrauensverhältnis zu ihren Berufsbildenden sowie einen Rahmen, der es ihnen ermöglicht, ohne Bedenken aus Fehlern zu lernen.
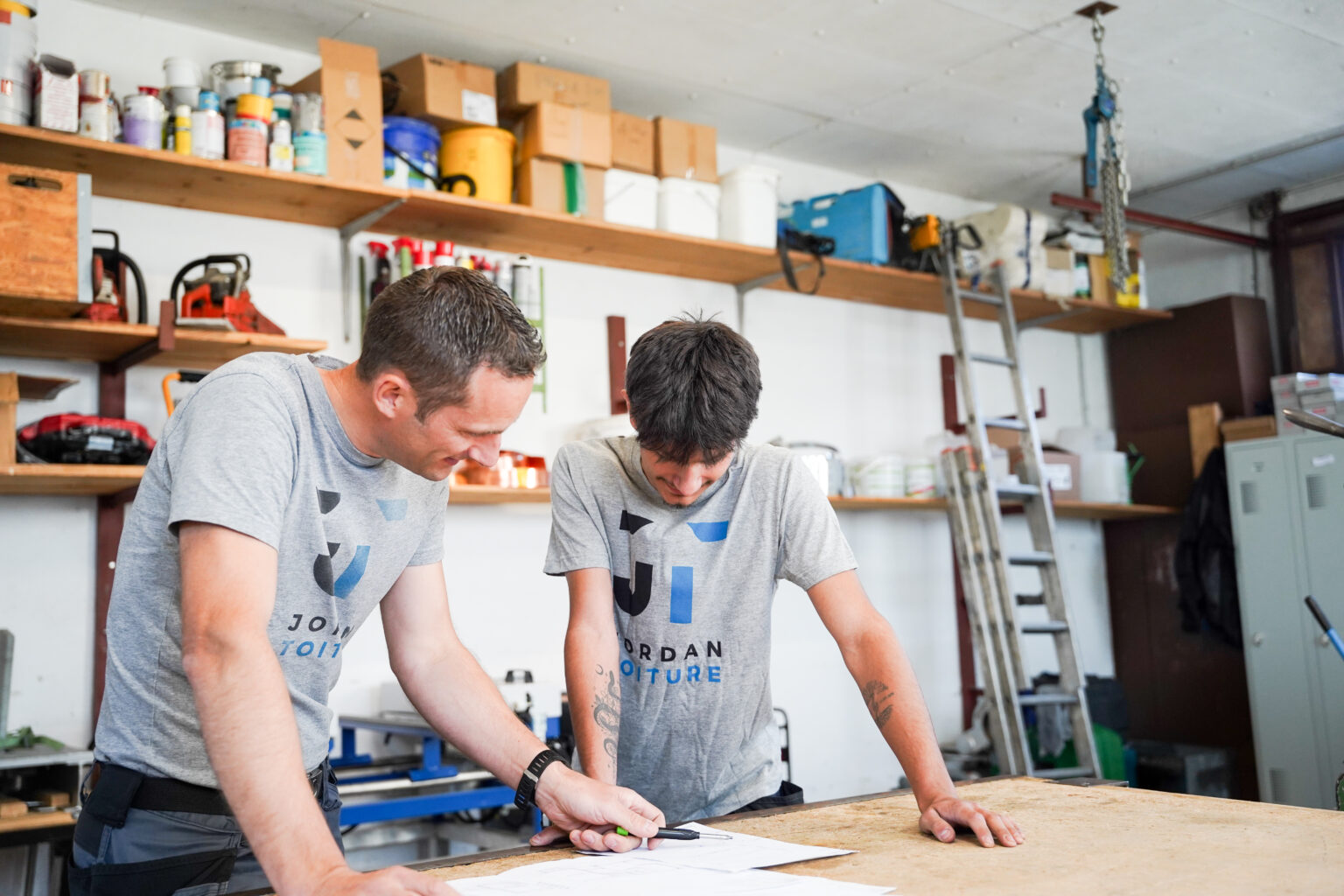
Mehr als nur eine Berufslehre
Die Studie zeigt auch, welche persönliche Entwicklung die Berufsausbildung auslöst. Die Lernenden berichten, dass sie selbstbewusster, selbstständiger und zielgerichteter geworden sind. Fast 90 % geben an, heute verantwortungsbewusster, neugieriger und fleissiger zu sein als vor Beginn der Lehre. «Seitdem ich die Lehre begonnen habe, fühle ich mich nützlich. Ich weiss, wofür ich morgens aufstehe», sagt ein Teilnehmender der Umfrage.
Für Barbara Schmocker, Psychologin und Hauptautorin des Berichts, sprechen die Ergebnisse für sich: «Psychische Gesundheit ist mehr als nur das Fehlen von Symptomen. Sie umfasst auch Stolz, Motivation und das Gefühl, am richtigen Platz zu sein».
Die Umfrage verschleiert jedoch nicht die differenziertere Realität. Etwa sechs von zehn Lernenden geben an, schon einmal psychische Probleme erlebt zu haben, in unterschiedlich starker Ausprägung.
Dabei handelt es sich um Stress, Müdigkeit und Spannungen, in einzelnen Fällen auch um ausgeprägtere Störungen. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da die Frage sehr offen formuliert war und sowohl vorübergehende als auch länger andauernde Belastungen erfasst wurden. In der Praxis gibt nur rund ein Drittel der betroffenen Lernenden an, dass diese Schwierigkeiten ihre Ausbildung tatsächlich beeinträchtigt haben.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist die Resilienz der jungen Menschen: 90 % geben an, mit Schwierigkeiten gut umgehen zu können und drei Viertel fühlen sich in der Lage, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Die Mehrheit jener, die zeitweise einen Lehrabbruch in Erwägung gezogen hatten, nennt den eigenen Willen, das Vertrauen des Umfelds oder die Unterstützung der Eltern als wichtigste Kraftquellen, um durchzuhalten.


Debatte über die Ausbildungsbedingungen
Die meisten Schwierigkeiten sind jedoch vorübergehend und gefährden die Ausbildung nicht, auch wenn ein Viertel der Betroffenen angibt, dass diese Probleme einen grossen Einfluss auf ihren Werdegang hatten.
Die Studie zeigt auch, dass psychologische Hilfs- und Betreuungsangebote nach wie vor wenig bekannt sind oder kaum genutzt werden. Hier besteht klarer Handlungsbedarf für Schulen und Ausbildungsbetriebe: Diese Angebote sollten sichtbarer und zugänglicher gemacht und vor allem ihre Inanspruchnahme entstigmatisiert werden.
Mit 44 675 Rückmeldungen bietet die Umfrage einen soliden und repräsentativen Einblick.
Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), der Gesundheitsförderung Schweiz sowie mehreren Stiftungen durchgeführt. Die Antworten decken alle drei Sprachregionen des Landes ab. Für den FAV ist die Botschaft dieser Umfrage klar und bedeutend. «Die duale Berufsbildung bereitet nicht nur auf einen Beruf vor. Sie hilft den Jugendlichen auch, sich zu entfalten, sich zurechtzufinden und Selbstvertrauen zu gewinnen», betont Daniel Bürdel, stellvertretender Direktor.
In diesem Kontext, geprägt von einem wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung des Wohlbefindens in der Ausbildung, ist eine neue Forderung laut geworden. Im Juni 2025 wurde ein offener Brief an den Bundesrat gerichtet, in dem acht Wochen Ferien für Lernende anstelle der heute vorgesehenen fünf Wochen gefordert wurden. Diese Initiative wird vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) getragen.
Bedenken in Wirtschaftskreisen
Doch dieser Vorschlag stösst nicht auf einhellige Zustimmung. Auf Seiten der Arbeitgebenden und der Wirtschaftskreise, zu denen auch der Freiburger Arbeitgeberverband (FAV) zählt, wird klar vor den möglichen Folgen einer solchen Ferienverlängerung gewarnt. Wird die psychische Gesundheit der Lernenden als zentrale Herausforderung anerkannt, stellt sich die Frage, wie darauf reagiert werden kann, ohne ein System aus dem Gleichgewicht zu bringen, das auf der Ausbildung im Betrieb, dem Unterricht an der Berufsfachschule und den Erwartungen der Wirtschaft beruht.
Denn dieses Vorhaben könnte die Zeit, die Lernende im Ausbildungsbetrieb verbringen, weiter verkürzen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung für die Betriebe beeinträchtigen. «Die Gewährung zusätzlicher Ferienwochen könnte Ausbildungsbetriebe davon abhalten, Lehrstellen anzubieten, wodurch die Bildungsmöglichkeiten verarmen und das duale Berufsbildungssystem gefährdet würde», erklärt der stellvertretende Direktor des FAV.
Weitere Stimmen warnen vor einem möglichen Ungleichgewicht zwischen betrieblicher Ausbildung und schulischem Unterricht. So betonte der Direktor des Berufsbildungsamts des Kantons Genf, dass jede Verlängerung der Ferien die ohnehin schon dichte und anspruchsvolle Prüfungsvorbereitung behindern könnte.
Zu diesen pädagogischen Erwägungen kommen finanzielle Bedenken hinzu. In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld bezeichnete der Grosse Rat des Kantons Genf die Idee einer Ferienverlängerung als «unrealistisch» und verwies auf die zusätzlichen Kosten, die dadurch entstünden.
Schliesslich plädiert man auf Seiten der FDP für mehr Flexibilität und Spielraum für die Arbeitgebenden, damit sie ihr Ausbildungsangebot – Löhne, Ferien, Vergünstigungen – frei nach ihren Möglichkeiten gestalten können, um attraktive Ausbildungsplätze ohne standardisierte Vorgaben anbieten zu können. «Die Vielfalt der Modelle ist auch ein Reichtum des dualen Systems», erinnert Daniel Bürdel.



